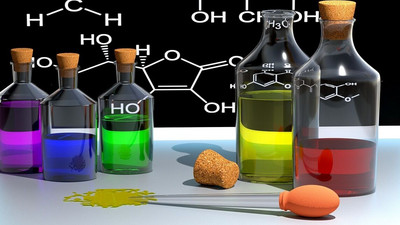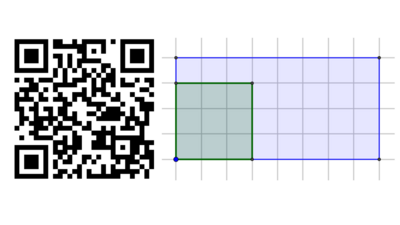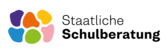Zielbereiche Digitaler Lernaufgaben
Die zentrale Anforderung an Digitale Lernaufgaben ist die Ausrichtung an den Zielbereichen. Der Orientierungsrahmen formuliert insgesamt vier Zielbereiche, von denen mindestens einer im Fokus der Aufgabenkonzeption stehen sollte. Wir stellen Ihnen die Zielbereiche zusammen mit ihren jeweiligen Unterbereichen hier im Überblick vor. Klicken Sie auf Überblick, um den jeweiligen Zielbereich kennenzulernen.

Zielbereich 1
Die Aufgabe greift Themen und Formate der von der Digitalisierung geprägten Welt auf.

Zielbereich 2
Die Aufgabe fördert individuelle Lernprozesse.

Zielbereich 3
Die Aufgabe fördert Zusammenarbeit.

Zielbereich 4
Die Aufgabe ist handlungs- und/oder produktorientiert.

Die Zielbereiche im Überblick
Laden Sie sich die kompakte Übersicht über die Zielbereiche digitaler Lernaufgaben als PDF-Datei herunter.
Lernen Sie die Zielbereiche ausführlich kennen!
Wir empfehlen Ihnen, auch die folgenden ausführlichen Beiträge zu den einzelnen Zielbereichen zu lesen. Diese bieten Ihnen weiterführende Informationen zu den Zielbereichen mit entsprechenden Bezügen zu wissenschaftlichen Evidenzen und mediendidaktischen Konzepten sowie passende Beispiele.
Mitwirkende dieses Artikels
Empfohlene Zitierweise
Arlt, J., Auburger, M. & Luber, I. (2025): Zielbereiche Digitaler Lernaufgaben. In: , ISB-Magazine "". Verfügbar unter: https://www.isb.bayern.de/aktuelles/digitale-lernaufgaben/zielbereiche-digitaler-lernaufgaben/
Vorheriger Artikel:
Merkmale Digitaler Lernaufgaben
Nächster Artikel: