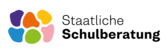Selbstverständnis der Fachschaftsleitung
Verantwortlich wahrgenommene Führung arbeitet – eingebettet in das Schulentwicklungsgeschehen als Ganzes – team-, ziel- und lösungsorientiert. Um die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben im Rahmen der Unterrichtsentwicklung und der Qualitätssicherung wahrnehmen zu können, sind sich Fachschaftsleiterinnen und Fachschaftsleiter neben der grundlegenden fachlichen Kompetenz weiterer Aspekte ihrer Führungsrolle bewusst.
Fachliche Führung entsteht auf unterschiedlichen Ebenen, die einander nichts nehmen. Insbesondere gehört zu einer förderlichen Begleitung auch Klarheit über Erreichtes und zu Erreichendes im Sinne der Schülerinnen und Schüler.
Grundlegende Aspekte fachlicher Führung
Ebene 1: Begleiten, Orientieren
- Welche Standards gelten?
- Welche Ziele strebt die Lehrkraft an? Wie kann die Fachschaftsleitung sie bei der Zielerreichung unterstützen?
- Was gilt als ein gutes Arbeitsergebnis im eigenen Fachbereich?
Fachschaftsleitung fördert, unterstützt, sorgt dafür, dass die Lehrkräfte wissen, was von ihnen erwartet wird, und fordert Ergebnisse ein.
Ebene 2: Beurteilen
- Hat die Lehrkraft die vereinbarten Ziele erreicht?
- Wie bringt sie sich ein?
- Welche Entwicklung kann innerhalb des Beurteilungszeitraums festgestellt werden?
Fachschaftsleitung leistet einen Beitrag zur Dienstlichen Beurteilung.
Ebene 3: Gestalten, Entwickeln
Fachschaftsleitung bringt sich mit ihrem Fach in die strategische Ausrichtung der Schule ein, entwickelt die fachliche Qualität und den Unterricht weiter und hat förderliche Arbeitsbedingungen im Blick.
Die Haltung, die die Fachschaftsleitung einnimmt, ist entscheidend für den Erfolg in ihrer Rolle. Begeisterung und Engagement für das Fach bzw. den Beruf tragen dazu ebenso bei wie personale Faktoren, die auf der Basis von Selbstreflexion und der Bereitschaft, eigenes Handeln immer wieder zu hinterfragen, erworben und ausgebaut werden. Die Fähigkeit zu teamorientiertem Arbeiten sowie ein Repertoire an prozessorientierten Maßnahmen der Gruppenleitung animieren auch die Mitglieder der Fachschaft zur Partizipation. Gemeinsam getragene Entscheidungen tragen dazu bei, dass die Fachschaftsarbeit von gegenseitigem Vertrauen geprägt wird und die Schülerinnen und Schüler im Alltag von Weiterentwicklungen profitieren.
Zu den Aufgaben der Fachschaftsleiterin bzw. des Fachschaftsleiters gehört auch ein Beitrag zur Dienstlichen Beurteilung der Lehrkräfte. Dienstliche Beurteilungen haben zum einen – als Instrument der Personalführung und der Qualitätssicherung – die Aufgabe, der einzelnen Lehrkraft zu zeigen, welches Leistungs-, Befähigungs- und Eignungsbild von ihr gewonnen wurde. Zum anderen ermöglicht die dienstliche Beurteilung einen vergleichenden Überblick über das Leistungs- und Eignungspotenzial der Lehrkräfte; sie bildet so die wesentliche Grundlage der Auswahlentscheidungen für die Übernahme von Funktionsstellen an der eigenen Schule und über die eigene Schule hinaus. Diese Zielsetzungen erreicht die dienstliche Beurteilung nur, wenn sie nach den Geboten der Gleichmäßigkeit, Gerechtigkeit und Sachlichkeit erstellt wird. Damit die Schulleiterin bzw. der Schulleiter diese Anforderungen erfüllen und dabei den Lehrkräften der verschiedenen Fachschaften insbesondere auch in fachlicher Hinsicht gerecht werden kann, ist es wichtig, dass die jeweilige Fachschaftsleitung aus einer objektivierten Perspektive heraus einen differenzierten und sachgerechten Beurteilungsbeitrag über jede einzelne Lehrkraft der Fachschaft abgibt. Bei der Erstellung der Beurteilungsbeiträge muss die Fachschaftsleitung daher sicherstellen, dass das Leistungsspektrum der Fachschaft fair und differenziert abgebildet wird.
Hierzu empfiehlt es sich, dass die Fachschaftsleiterin bzw. der Fachschaftsleiter für jede Lehrkraft der Fachschaft Aufzeichnungen über Leistung, fachlich-pädagogische Kompetenz und Engagement anfertigt. Neben Verbesserungspotenzialen spielen wesentliche Arbeitsergebnisse und Erfolge eine Rolle bei der Beurteilung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Einschätzung der Fähigkeit einer Lehrkraft, Entwicklungen anzugehen und Rückmeldungen erfolgreich in die Praxis zu implementieren.
Für die Fachschaftsleiterin bzw. den Fachschaftsleiter ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass auf der Grundlage der mit der Unterrichtsentwicklung und Qualitätsentwicklung verbundenen Aufgaben der Ebene 3 (Gestalten/Entwickeln) zwischen den Aufgaben der Ebene 1 (Unterstützen/Beraten) und denen der Ebene 2 (Beurteilen) kein Widerspruch herrschen muss. Die Fachschaftsleitung hat an der Rahmensetzung der Schulleitung für die gesamte Schule Anteil und ist für die Entwicklung des Teilbereichs zuständig, der sich für sie ergibt. Damit setzt sie als fachliche Führungskraft wiederum den Rahmen für die Mitglieder ihrer Fachschaft, innerhalb dessen sie sich einbringen und ihre Vorstellungen von verantwortungsvollem, professionellem Handeln als Lehrkraft verwirklichen können. Gemeinsames Entwickeln von Projekten, eine gute Rückmeldekultur und ein Schulklima, in dem Zusammenarbeit und Austausch funktionieren, tragen dazu bei, dass sich die Beteiligten offen mit Stärken und Schwächen ihrer Schule, aber auch ihrer eigenen Person auseinandersetzen.
Die Fachschaftsleitung übernimmt eine wichtige Rolle als Vorbild, Multiplikator und Initiator, von ihr gehen Anstöße in methodischer, didaktischer und pädagogischer Hinsicht aus; sie schafft gleichzeitig den Rahmen dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Kompetenzen und Potenziale für das Erreichen der gemeinsamen Ziele – gründend im Bildungs- und Erziehungsauftrag – einbringen und diese für die fachliche und fächerübergreifende (Zusammen‑)Arbeit sowie zur Entlastung in der Fachschaft genutzt werden.
Das wichtigste Steuerungs- und Gestaltungselement ist dabei die Kommunikation. Bei professionell gestalteter Kommunikation gelingt es Führungskräften,
- sich klar, sachlich und wertschätzend auszudrücken,
- aktiv zuzuhören,
- komplexe Gesprächsgegenstände und ‑verläufe zu strukturieren,
- eine sorgfältige Zielklärung vorzunehmen,
- bestimmte, als wichtig erkannte Inhalte in den Fokus zu rücken,
- Raum für den Diskurs aller Beteiligten und deren Sichtweisen zu lassen und diese Phasen besonders sorgfältig zu strukturieren,
- für Verbindlichkeit zu sorgen.
Die Fachschaftsleitung ist sich der Verantwortung, die mit der eigenen Rolle verbunden ist, bewusst. Als fachliche Führungskraft berücksichtigt sie daher vor allem
- das gemeinsame höher zu gewichtende Interesse aller Beteiligten,
- die Sicherung und Verbesserung der Unterrichtsqualität sowie
- die Vergleichbarkeit der Anforderungen zum Wohl der Schülerinnen und Schüler.
Dieser Prozess erfordert auch, ggf. eigene Interessen und Positionen zu hinterfragen, andere berechtigte Perspektiven zu berücksichtigen und – soweit möglich – einen Ausgleich zu erwirken.
Die Fachschaftsleitung sammelt alle für die Arbeit der Fachkolleginnen und ‑kollegen erforderlichen Informationen (z. B. Fachschaftsbeschlüsse, Erkenntnisse aus der Respizienz) und gibt diese an die Fachschaft weiter, insbesondere an neue Fachschaftsmitglieder. Sie stellt sicher, dass bei einem personellen Wechsel alle Informationen verfügbar bleiben. Gleichzeitig ist jede Lehrkraft verpflichtet, sich wesentliche Informationen selbst zu beschaffen (z. B. amtliche Veröffentlichungen, vgl. § 17 LDO).