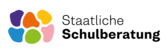Aufgaben der Fachschaftsleitung in der Fachschaft: Respizienz
Die Respizienz ist ein zentrales Element der Qualitätssicherung und Unterrichtsentwicklung: Unterricht, Kompetenzerwerb und Feedback sind eng miteinander verknüpft.
Wesentliche Anliegen der Respizienz sind daher
- die Gewährleistung angemessener Anforderungen und einer zutreffenden, transparenten Bewertung der Schülerleistungen,
- das Erreichen der Vergleichbarkeit von Leistungsnachweisen innerhalb der Fachschaft, innerhalb einer Jahrgangsstufe sowie (durch gemeinsam definierte Standards) innerhalb der Schule und
- die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, das Schaffen eines Ausgangspunktes für die weitere Beratung.
Der Funktionenkatalog führt hierzu folgende Aufgaben auf:
„Qualitätsentwicklung im Vorfeld schriftlicher Leistungsnachweise, Durchsicht der Schulaufgaben und Kurzarbeiten bzw. in Fächern, in denen keine Schulaufgaben geschrieben werden, Durchsicht kleiner schriftlicher Leistungsnachweise (insb. anfallende Stegreifaufgaben und Kurzarbeiten), jeweils mit dem Ziel, die Vergleichbarkeit der Anforderungen in einer für die Schulleitung und die Fachkollegin bzw. den Fachkollegen transparenten Form regelmäßig zu gewährleisten“
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter und die Fachschaftsleitungen stimmen verantwortungsvolle schulinterne Regelungen zum Vorgehen in der Respizienz ab. Dabei stehen die Qualitätssicherung sowie die Konzentration auf das Wesentliche im Mittelpunkt.
Die Regelungen umfassen insbesondere:
- Grundsätze der Respizienz (Angemessenheit, Bedarfsgerechtheit, Transparenz)
- Kriterien, Umfang und Intensität der Verfahren
- das Prozedere zur Evaluation und Weiterentwicklung der Respizienzpraxis
Die Endverantwortung für die Qualität der Leistungserhebungen an der einzelnen Schule trägt die Schulleitung (vgl. § 27 Abs. 4 LDO).
Kriterien der Respizienz
Bei der Konzeption von Leistungsnachweisen wird grundsätzlich darauf geachtet, dass sich
- die Umsetzung des Lehrplans,
- die geltenden Standards (z. B. fachbezogene KMS, u. a. zu Aufgabenformaten, Operatoren, Anforderungsbereichen),
- Fachschaftsbeschlüsse,
- Vereinbarungen in der Schulgemeinschaft (z. B. MODUS-Maßnahmen),
- die von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu erwerbenden Kompetenzen sowie
- eine klare Zielorientierung (vor allem im Hinblick auf die Abiturprüfung) durch das progressionsbewusste Einüben von Aufgabenstellungen
erkennbar widerspiegeln.
Bei der Respizienz werden bedarfs- und zielorientiert u. a. folgende Kriterien reflektiert:
- Vergleichbarkeit von Aufgabenstellung, Korrektur und Bewertung
- Aufgabenstellung (Lehrplankonformität, Formulierung, Einsatz von Operatoren, Berücksichtigung unterschiedlicher Anforderungsbereiche, Anwendungsbezug, Jahrgangsstufen- und Arbeitszeitangemessenheit, äußere Form), vgl. §§ 21–24 GSO
- Korrektur (fachliche Richtigkeit, Transparenz, Berücksichtigung von Sprachrichtigkeit und äußerer Form), vgl. § 25 GSO
- Bewertung (Erwartungshorizont, Nachvollziehbarkeit, innere Stimmigkeit, Notenverteilung), vgl. § 26 GSO
- schul- bzw. fachschaftsinterne Vereinbarungen an der Schule
Umfang der Respizienz
- Vereinfachte Respizienzverfahren kommen insbesondere für Arbeiten (mit unauffälliger Notenverteilung) erfahrener bzw. bewährter Lehrkräfte zum Einsatz, z. B. Beschränkung auf die Aufgabenstellung, Stichproben.
- Ausführlichere Respizienzverfahren kommen v. a. bei dienstjungen bzw. an der Schule neuen Lehrkräften, bei Lehrkräften mit Unterstützungsbedarf (z. B. bei sich häufenden Beschwerdefällen) oder bei Arbeiten mit ungewöhnlicher Notenverteilung in Betracht: Hier werden insbesondere Aufgabenstellung, Korrektur und Bewertung mehrerer Schülerarbeiten verschiedener, aber durchaus auch gleicher Notenstufen einbezogen.
Eine „Nachkorrektur“ von Schülerarbeiten durch die Fachschaftsleiterin bzw. den Fachschaftsleiter ist im Rahmen der üblichen Respizienz weder beabsichtigt noch zielführend, da sie die Schülerinnen und Schüler nicht erreicht. Bei Beschwerdefällen kann eine Nachkorrektur erforderlich sein.
Unter besonderen Umständen kann es angebracht sein, dass die Schulleiterin bzw. der Schulleiter die Arbeit noch vor abgeschlossener Respizienz vorgelegt bekommt, um nötigenfalls frühzeitig entscheiden zu können, ob der Leistungsnachweis für ungültig erklärt und neu angefertigt werden muss (vgl. § 22 Abs. 7 GSO bzw. Art. 57 Abs. 2 Satz 1 BayEUG).
Berichterstattung und Rückmeldung
Unterricht, Kompetenzerwerb und Feedback sind eng miteinander verknüpft. Respizienz steht dabei im Kontext von wertschätzender Feedbackkultur auf verschiedenen schulischen Ebenen. Damit sowohl die Unterrichtsqualität gesichert und weiterentwickelt werden als auch eine förderliche Feedbackkultur entstehen kann, ist es notwendig, zentrale aus der Respizienz gewonnene Erkenntnisse an die Lehrkraft (und ggf. auch an die Schulleitung) zu kommunizieren und ggf. in der Fachschaft für Fragen der Weiterentwicklung zu nutzen. Nur so lässt sich das Gestaltungspotenzial der Respizienz zielgerichtet und effizient nutzen. Daher sollte die Respizienz so frühzeitig wie möglich durchgeführt werden, damit wesentliche Erkenntnisse in schulischen Prozessen wirksam werden können.
Die Respizienz wird gemäß den Vereinbarungen an der Schule knapp (ggf. digital) dokumentiert (z. B. in standardisierten Respizienzbögen). Im Fokus steht dabei die Ausrichtung auf die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität; z. B. welche Erkenntnisse in Fachschaftssitzungen oder mit der einzelnen Lehrkraft besprochen werden könnten. Die Dokumentation unterstützt auch die Erstellung sachgerechter Beurteilungsbeiträge.
Respizienzgespräche finden mit den Fachkolleginnen und -kollegen in vertraulicher Atmosphäre statt. Solche Gespräche sollen Rückmeldung über die geleistete Arbeit geben und Raum für Anerkennung, positive Verstärkung und Wertschätzung bieten. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, sachlich und fachlich Notwendigkeiten der Weiterentwicklung darzulegen.
Fachschaftsleitungen leisten gemäß den jeweils geltenden Beurteilungsrichtlinien der Schulleitung Beiträge zur dienstlichen Beurteilung. Schriftliche Beurteilungsbeiträge müssen der beurteilten Person auf Anforderung offengelegt werden (Einsichtnahmerecht gemäß Art. 107 BayBG). Bei der Erstellung des Beurteilungsbeitrags, in den auch Erkenntnisse aus der Respizienz einfließen, sollte die Fachschaftsleitung daher darauf achten, dass Form und Inhalt der Dokumentation zur Offenlegung geeignet sind.
Respizienz der Arbeiten der Fachschaftsleitungen und Schulleitungsmitglieder
Im Sinne der Qualitätssicherung und entwicklung sowie des fachlicher Führung zugrundeliegenden Führungsverständnisses sollten auch die Arbeiten von Fachschaftsleiterinnen bzw. Fachschaftsleitern und Mitgliedern der (erweiterten) Schulleitung respiziert werden. Das Prozedere legt die Schulleitung fest (z. B. Respizienz durch eine andere Fachschaftsleiterin bzw. einen anderen Fachschaftsleiter mit gleicher Fakultas oder ein besonders kompetentes Fachschaftsmitglied).