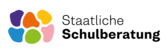Aufgaben der Fachschaftsleitung in der Fachschaft
Die Fachschaftsleitung sichert durch gezielte Unterstützung und Beratung die fachwissenschaftliche, fachdidaktische und pädagogische Qualität des Unterrichts und gestaltet die fachliche Weiterentwicklung aktiv mit. Sie stärkt die Fachschaftsmitglieder in ihrer Eigenverantwortung beim Erreichen der Qualitätsziele durch Unterstützung und Beratung. Dazu wird eine transparente und professionelle Rückmelde- und Beratungskultur gepflegt, zu der u. a. regelmäßiges positives Feedback für gut geleistete Arbeit gehört.
Unterstützen und Beraten
Zur erfolgreichen Ausübung ihrer Funktion muss die Fachschaftsleitung auch über Fragen ihres Fachs möglichst umfassend und aktuell informiert sein. Sie stellt allen Beteiligten alle grundsätzlich relevanten bzw. im Bedarfsfall benötigten Informationen zeitnah zur Verfügung. So können sich die Kolleginnen und Kollegen darauf verlassen, dass sie über notwendige Informationen verfügen, was sie allerdings nicht davon entbindet, aktiv Informationen einzuholen.
Suchen Fachschaftsmitglieder den Rat der Fachschaftsleitung, geht es häufig um fachwissenschaftliche, fachdidaktische, schulrechtliche oder pädagogische Fragen, Unsicherheiten bei der Notengebung oder Möglichkeiten der Fortbildung. Aufgrund der Position der Fachschaftsleitung als fachliche Führungskraft haben dienstliche Auskünfte für die jeweilige Fachlehrkraft in der Regel eine Verbindlichkeit, auf die sich die Ratsuchende bzw. der Ratsuchende berufen kann.
Gerade in Beratungsfragen, die über reine Information aufgrund der Kompetenz der Fachschaftsleitung hinaus gehen, achtet die Fachschaftsleitung darauf, vorschnelle Empfehlungen zu vermeiden als vielmehr dem Ratsuchenden zu helfen, selbst eine seinem Fall angemessene Lösung zu finden.
Bei Gesprächsbedarf vonseiten der Lehrkraft oder der Fachschaftsleitung (z. B. aufgrund von Beobachtungen aus der Respizienz oder in Beschwerdefällen) bietet es sich an, zunächst einen konkreten Termin mit ausreichend Zeit zu vereinbaren und den Anlass zu nennen.
Während des Gesprächs sollte die Fachschaftsleiterin bzw. der Fachschaftsleiter folgende Punkte beachten:
- Zu Beginn werden Inhalte und Ziele des Gesprächs für alle Gesprächspartner klar definiert.
- Der Sachverhalt wird geklärt, auch indem die Lehrkraft diesen aus eigener Perspektive darstellt.
- Grundlage des Gesprächs ist stets argumentative Sachbezogenheit. Dazu gehört ggf. auch, dass Kritik früh, inhaltlich klar und präzise formuliert wird.
- Ziel des Gesprächs ist es, gemeinsam Lösungen zu entwickeln; je nach Gegenstand wird eine schrftliche Fixierung und ggf. eine Zielvereinbarung dokumentiert.
Sicherlich stößt die Fachschaftsleitung manchmal auch an die Grenzen ihrer Beratungstätigkeit. Dies betrifft vor allem die folgenden Fälle:
Forderung nach hoher Beratungsintensität:
Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder eine Beratung durch die Fachschaftsleitung einfordern, müssen auch zurückgewiesen werden können.
Nimmt die Fachschaftsleitung eine übertriebene Vereinnahmung ihrer Person wahr, ist es angebracht, klare Grenzen zu ziehen – nicht nur im Sinne der eigenen Gesundheit und Berufszufriedenheit, sondern auch, um auf die Eigenverantwortung der Lehrkräfte hinzuweisen und sie darin zu stärken.
Beratungsresistenz:
Wenn sich Kolleginnen und Kollegen der notwendigen Beratung verweigern oder gemeinsam getroffene Zielvereinbarungen nicht einhalten, muss die nächsthöhere Entscheidungsebene, also die Schulleitung, einbezogen werden, damit notwendige Zielvorgaben durch verbindliche Weisungen ergänzt oder ersetzt werden können.
Dies ist insbesondere bei folgenden klaren dienstrechtlichen Verstößen erforderlich:
- Nichteinhaltung des Lehrplans
- Missachtung von Bestimmungen der Schulordnung, zum Beispiel in Bezug auf Arbeitszeit, Umfang, fristgerechte Rückgabe von Leistungsnachweisen
- Ignorieren des Nachteilsausgleichs
Soweit der Fachschaftsleitung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 LDO Weisungsbefugnis übertragen wurde, kann sie im Rahmen ihrer fachlichen Führungsaufgabe auch durch das Mittel der Weisung auf ein Abstellen der Mängel hinwirken.
Das Einbeziehen der Schulleitung bleibt weiterhin möglich und kann bisweilen nötig sein.
In Fällen der Beratungsresistenz empfiehlt es sich, Weisungen schriftlich zu erteilen und sich den Erhalt durch Unterschrift bestätigen zu lassen.
Gestalten und Entwickeln
Fachschaftsleiterinnen und Fachschaftsleiter gestalten die Entwicklung von Schule und Unterricht an wichtigen Stellen mit. Ihre fachliche Expertise befähigt sie dazu, die Qualität des Fachunterrichts federführend zu sichern und auszubauen. Dazu stehen der Fachschaftsleiterin bzw. dem Fachschaftsleiter
- Fachsitzungen,
- schulinterne Fortbildungen,
- die Respizienz,
- Gespräche mit den Mitgliedern der Fachschaft,
- die Weitergabe der Erkenntnisse aus Fortbildungen,
- der produktive Austausch mit anderen Fachschaften sowie
- die spezifische Kommunikation im System Schule
zur Verfügung. Auch die Implementierung einer Kultur fest vereinbarter kollegialer Hospitationen mit anschließender Reflexion ist ein wichtiges Element der Unterrichtsentwicklung.