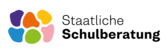Aufgaben der Fachschaftsleitung bei der Öffnung der Schule nach außen
Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich für die Fachschaftsleiterin bzw. den Fachschaftsleiter nicht nur schulintern, sondern auch nach außen. Im Sinne einer Förderung des Fachunterrichts und der Belange des Fachs reichen die Kontakte einer aktiven Fachschaftsleitung weit über die schulinterne Kooperation hinaus, sei es bei der Vertretung der Schule, beim Kontakt mit externen Partnern, bei der Fortbildung oder bei der schul- und schulartübergreifenden Zusammenarbeit. Als Repräsentantin bzw. Repräsentant des Fachs und der Fachschaft ist die Fachschaftsleiterin bzw. der Fachschaftsleiter eine zentrale Schaltstelle für vielfältige Fachinformationen nach innen und außen. Außerschulische Kontakte bringen vielseitige Anregungen, von ihnen kann eine hohe Motivationskraft ausgehen. Zudem ergeben sich innerhalb der Schulgemeinschaft zahlreiche Synergieeffekte durch Kontakte mit außerschulischen Partnern.
Auch wenn als rechtliche Grundlage für die Aufnahme und Pflege außerschulischer Kontakte grundsätzlich gilt, „[d]ie Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule nach außen“ (Art. 57 Abs. 3 BayEUG), so wird die Schulleiterin bzw. der Schulleiter es als zweckmäßig erachten, wenn von den zahlreichen Kontakten im Sinne einer Entlastung ein Teil verlässlich von den Fachschaftsleitungen der Schule übernommen wird.
Für außerschulische Kontakte ist grundsätzlich zu beachten:
- Abstimmung vor der Kontaktaufnahme mit der Schulleitung
- angemessener Informationsfluss über alle Außenkontakte
Zu beachten ist, dass Mitteilungen an die Presse in jedem Fall vorab durch die Schulleitung genehmigt werden müssen.
- für die Fachkolleginnen und ‑kollegen:
- fachliche Weiterbildung
- Anregungen aus Wissenschaft, Wirtschaft, kulturellem Leben
- für die Schülerinnen und Schüler:
- lebensnahe Anwendung schulischen Wissens
- Einblicke in die Arbeitswelt und Berufsvielfalt
- für den Bereich der P- und W‑Seminare:
- Aufbau und Vermittlung von (vor allem berufsrelevanten) Kontakten zu verschiedenen externen Partnern
- für die Schule insgesamt:
- Aufbau eines Netzwerks vielfältiger Ansprechpersonen sowie Fachexpertinnen und ‑experten
- aktive und positive Außendarstellung der Schule
- Sympathiewerbung bei Wirtschaftsbetrieben und Behörden
- Gewinnen von Sponsoren (vgl. Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 14.09.2010, Az.: B II 2 G24/10)
Die folgende Übersicht nennt mögliche außerschulische Partner:
fachnahe Institutionen
- alle Fächer: die verschiedenen Institute der Universitäten und Hochschulen sowie Museen (MPZ und museumspädagogischer Dienst als weitere Ansprechpartner)
- Fremdsprachen: fremdsprachliche Institute, Konsulate und Generalkonsulate
- gesellschaftswissenschaftliche Fächer: Bundes- und Landeszentrale(n) für politische Bildung
- Religionslehre: religionspädagogische Zentren der Kirchen und Glaubensgemeinschaften mit Materialstellen
- MINT-Fächer: Schülerlabore, Schülerforschungszentren, MINT-Regionen etc.
- Sport: Vereine
Aufgabe der Fachschaftsleitung: Prüfung, Auswahl und Weitergabe attraktiver Veröffentlichungen und Fortbildungsangebote an die Fachkolleginnen bzw. ‑kollegen Prüfung, Auswahl und Weitergabe geeigneter Materialien und Fortbildungsangebote (hier finden sich häufig geeignete Ansprechpartner für Projekt-Seminare)
Behörden
- Ministerien, v. a. Innenministerium, Sozialministerium, Justizministerium, Umweltministerium
- Bundeswehr: Kontakt mit Schulen über die Jugendoffiziere
- auf lokaler und regionaler Ebene Vertretungen der Kommunen, Gesundheits- und Justizbehörden, Forst- und Landwirtschaftsämter, gewählte Politikerinnen und Politiker etc.
- Lehrerbildungszentren
Aufgabe der Fachschaftsleitung: Anforderung unterrichtsbezogener Informationen und Materialien, Einladung geeigneter Fachexperten in den Unterricht
fächerübergreifend tätige Institutionen, z. B.
- Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
- Akademie für Politische Bildung Tutzing
- Europäische Akademie
- Evangelische Akademie in Bayern
- Katholische Akademie in Bayern
- Stiftungen
- FWU etc.
Aufgabe der Fachschaftsleitung: Sichtung, Auswahl und Weitergabe fachlich relevanter Materialien und Fortbildungsangebote
Verbände (Fachverbände und Lehrerverbände)
Aufgabe der Fachschaftsleitung: Prüfung, Auswahl und Weitergabe attraktiver Veröffentlichungen und Fortbildungsangebote an die Fachkolleginnen bzw. ‑kollegen
Schulbuchverlage
Aufgabe der Fachschaftsleitung: sorgfältige Prüfung aller am Markt befindlichen Angebote bei der Einführung neuer Lehrwerke
kulturelle Angebote
Aufgabe der Fachschaftsleitung: sinnvolle Auswahl aus den Angeboten von Theatern und Konzerten, Museen und Ausstellungen, Galerien und Kinos für Schulveranstaltungen
Partnerschulen im Ausland
Aufgabe der Fachschaftsleitung: Koordination und Unterstützung gemeinsamer Projekte sowie individueller und in Gruppen durchgeführter Schüleraustausche
Partner in der Wirtschaft
Aufgabe der Fachschaftsleitung: Aufbau breit gefächerter Kontakte und Netzwerke, insbesondere im Hinblick auf die P- und W‑Seminare, Arbeitskreise Schule/Wirtschaft
In Abhängigkeit von der Größe, von den jeweiligen Überschneidungen in den Ausbildungsrichtungen und von den räumlichen Entfernungen der Schulen voneinander kann und muss die schulübergreifende Zusammenarbeit unterschiedliche Form und Intensität besitzen.
Der Kontakt mit Fachschaftsleitungen gleicher Fächer an den Nachbarschulen soll im Bewusstsein der besseren Wahrnehmung von Chancen gegenseitiger Bereicherung regelmäßig gepflegt und über die in etwa jährlichem Abstand stattfindenden Tagungen für die Fachschaftsleitungen auf Ebene der Regierungsbezirke hinausgehend intensiviert werden: Ziel ist die Anregung von Kooperation und der Austausch von Erfahrungen. Bewährt hat sich u. a., eine externe Referentin bzw. einen externen Referenten zu einer gemeinsamen schulinternen Lehrerfortbildung einzuladen.
In allen MB‑Bezirken sind für die meisten Fächer fachliche Regionalteams gebildet, denen die jeweilige Fachreferentin bzw. der jeweilige Fachreferent, eine Fachschaftsleitung und eine Seminarlehrkraft angehören. Die fachliche Führungsaufgabe im MB‑Bezirk wird dadurch auf eine breitere Basis gestellt. An der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen (ALP) treffen alle Regionalteams in Jahrestagungen mit den entscheidenden Fachmultiplikatoren von ISB, ALP und Staatsministerium zusammen, um aktuelle und langfristige fachliche Entwicklungen zu begleiten und den Führungs- und Gestaltungsauftrag der fachlichen Funktionsträger zu unterstützen.
Der Fachschaftsleitung kommt die Verantwortung zu, das Fachkollegium zu sensibilisieren, die Inhalte und Methoden ihres Fachs in schulartübergreifender Hinsicht zu reflektieren. Gerade mit Blick auf den LehrplanPLUS, der auf Übergänge zwischen den einzelnen Schularten achtet, ist dies unbedingt notwendig. Dies umfasst beispielsweise folgende Aspekte:
- Anknüpfung an die Lehr- und Lernmethoden insbesondere der Grundschule, aus der ein Großteil der Schülerinnen bzw. Schüler ans Gymnasium kommt, Anregung von Hospitationen und produktiver Formen der Zusammenarbeit mit den Grundschulen
- Unterstützung bei Übertritten aus anderen oder an andere Schularten (Durchlässigkeit im differenzierten Schulwesen)
- Zentrale Prüfungen bzw. Lernstandserhebungen (z. B. Probeunterricht, Jahrgangsstufentests, Besondere Prüfung) und ggf. adäquate Vorbereitung dafür
- Anregung zur Kooperation
- Knüpfen persönlicher Kontakte und produktive Vernetzung der im Bildungssystem beteiligten Akteure, auch mit Blick auf den Übergang vom Gymnasium zur Hochschule bzw. den Eintritt ins Berufsleben